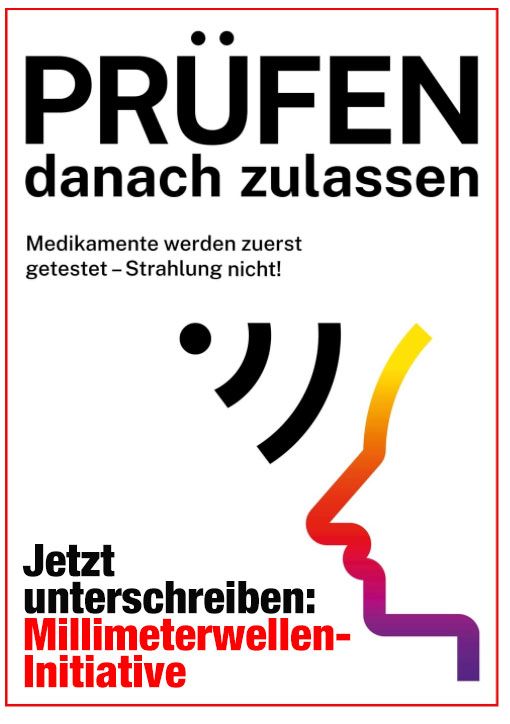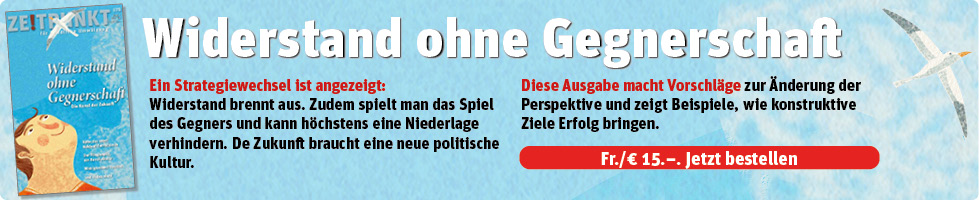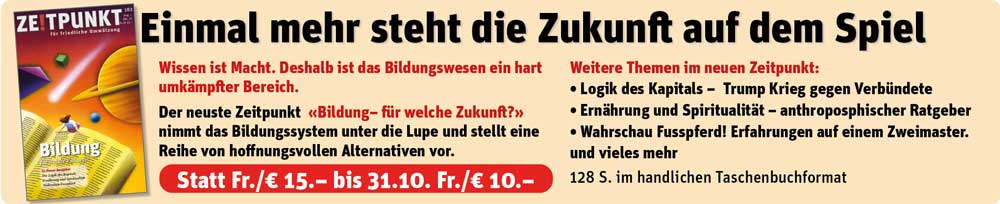Ich liebe das Schweizerkreuz. Ich liebe es, weil ich die Schweiz liebe. Ob es auf meinem Pass prangt, als Flagge im Winde flattert, für ein Schweizer Produkt wirbt, ob es im Ausland an mir vorbeifährt oder ob es Sportler auf ihrem Tenue tragen: Wo immer es mir begegnet, freue ich mich, es zu sehen.
Ich freue mich auch über die Schweizer Eishockeynationalmannschaft, wenn sie mit dem Schweizerkreuz auf der Brust in Reih’ und Glied auf der Eisfläche steht und aus vollen Kehlen die Hymne singt. Aber ich war wieder einmal naiv. Denn ein Gesetz, das vor sieben Jahren beschlossen wurde, unterscheidet zwischen dem blossen Kreuz und dem Wappen. Im Wappen ist das Schweizerkreuz eingerahmt. Das Wappen ist das offizielle Emblem der Schweiz und gehört dem Staat. Im Gegensatz zum Schweizerkreuz auf der Fahne darf das Wappenkreuz nur für amtliche, nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. So lautet die neue Vorschrift.
Ausnahmen müssen bewilligt werden. Die SAC-Hütten zum Beispiel dürfen das Wappen weiter verwenden und auf den Taschenmessern der Firma Victorinox darf es ebenfalls bleiben. Aber das Schweizerwappen am Eingang eines renommierten Lokals im Hauptbahnhof Zürich musste abgehängt werden, obwohl es schon seit 25 Jahren dort hing. Und jetzt geriet auch das Eishockeyteam ins Visier des Staates. Während nämlich die Fussballnati bloss noch ein kleines verschämtes Kreuz auf dem Tenue trägt, treten die Eishockeyaner nach wie vor mit dem Wappen auf. Und obwohl sie damit keine kommerziellen Zwecke verfolgen, dürften auch sie das Wappen nicht länger tragen. Eigentlich schon seit sieben Jahren nicht mehr. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes.
Was hat die Nationalmannschaft falsch gemacht?
Begeben wir uns zum besseren Verständnis des Geschehenen in eine Berner Amtsstube. In das Institut für Geistiges Eigentum. Da sehen wir eines Tages im März dieses Jahres einen Beamten des Instituts – einer von vielen – an seinem Bürotisch sitzen. Auf dem Tisch und in seinem PC stapeln sich die Pendenzen, doch der Beamte – es könnte auch eine Beamtin sein – wird vom Staat bezahlt, und der Staat muss das Geld nicht verdienen. Er nimmt den Lohn von den Steuereinnahmen. Von uns. Deshalb muss der Beamte nicht produktiv sein. Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass er keine Vorgaben hat, wieviele Pendenzen pro Tag er bearbeiten muss.
Nachdem er drei Gesuche erledigt hat, braucht er unbedingt eine Pause. Was wir durchaus verstehen können. Er surft ein wenig im weltweiten Netz – so stelle ich mir das vor – und stösst auf ein Bild, das die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft zeigt. Da fällt dem Beamten auf, dass auf dem Trikot der Spieler unübersehbar das Schweizerwappen aufgedruckt ist. Der Beamte wundert sich: Dass ihm das noch nie in die Augen stach!
Vielleicht verfolgt er selber die Spiele der Schweizer Nati, und er freut sich schon auf die WM im Mai. Vielleicht hat er selbst einmal Hockey gespielt. Aber das muss eine Weile her sein. Und vor allem ist er jetzt als Beamter gefordert. Darf denn unser Eishockeyteam, überlegt er sich, auf den Trikots das Wappen tragen? Eine Nationalmannschaft ist kein Bundesamt. Also müsste sie einen Ausnahmeantrag stellen.
Der Bundesbeamte wird aufgeregt. Er vergisst den Pendenzenberg, konsultiert das Gesetz, gräbt in den Dossiers, bespricht sich mit einem Kollegen – und findet heraus: Die Verantwortlichen der Eishockeynati haben die Frist verpasst! Bis ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes hätten sie Zeit gehabt, für das Schweizerwappen auf den Trikots eine Ausnahme zu erwirken. Das war vor sechs Jahren. Somit hat das Eishockeyteam schon sechs Jahre lang gegen das Wappengesetz verstossen. Eigentlich müsste das Team für den Missbrauch des Wappens verurteilt werden. Gemäss Gesetz mit einer Geldstrafe oder sogar mit Gefängnis.
Die Swiss Ice Hockey Federation wird sich erklären müssen – und die Medien werden sich darauf stürzen. Dies ist die grosse Stunde eines kleinen Beamten. An diesem Tag wird der Aktenstapel auf seinem Tisch nicht mehr kleiner. Unser wichtiger Mann im Institut für geistiges Eigentum hat an diesem Tag keine Zeit für sein Pflichtenheft. Er handelt jetzt in höherem Auftrag. Eine Nationalmannschaft darf sich keinen Gesetzesbruch leisten. Der Staatsdiener muss dafür sorgen, dass der kleine Skandal, den er aufgedeckt hat, an die richtige Stelle geht. Damit die Angelegenheit öffentlich wird.
Von den Medien wird die Beanstandung aus der Bundesverwaltung sogleich verbreitet. «Bund will Eishockey-Nati das Schweizer Wappen verbieten» titelt der Boulevard. Unser Beamter liest die Meldungen mit Genugtuung. Dass er namentlich nicht erwähnt wird, obwohl er die Verfehlung entdeckt hat, empfindet er nicht als Kränkung. Ein treuer Angestellter des Staates erwartet nicht, dass sein Name genannt wird. Er hat im Dienst der Sache gehandelt, im Namen der Bundesverwaltung. Doch er weiss: Dank seines persönlichen Engagements wird für Recht und Ordnung gesorgt. Der Beamte spürt die Macht, die er hat. Seine Arbeit ist plötzlich wichtig. Es kommt ihm so vor, als würde er plötzlich wahrgenommen. Als stehe er plötzlich im Rampenlicht.
*
Alles könnte ganz anders sein. Ein Wappengesetz müsste es gar nicht geben. Gesetze sind von Menschen gemacht, nicht von Gott. Wer immer das Schweizerkreuz für öffentliche oder private, gemeinnützige oder geschäftliche Zwecke verwenden will, sollte es tun dürfen. Denn er würde das Kreuz schon gar nicht verwenden, wenn er zu dessen Bedeutung keine positiven Gefühle hätte. Und selbst wenn ein Schweizer, der sein Land hasst, das Kreuz verunstalten würde, könnte man ihn gewähren lassen. Denn das ist die Meinungsfreiheit.
Doch nun gibt es dieses Gesetz – und vor allem gibt es Beamte, die sich, gefangen in einer bedrohlichen Eigendynamik, permanent neue Gesetze ausdenken, um sie danach überwachen zu können. Dafür wiederum sind weitere Beamte erforderlich, und auch diese Beamten denken sich wieder neue Gesetze und Vorschriften aus. Die furchterregende Kreativität der Bürokratie hat auch in unserem kleinen Land, wie man weiss, eine übermächtige Maschinerie geschaffen, der nicht nur wir, die Bürgerinnen und Bürger, ohnmächtig gegenüberstehen, sondern auch die Politiker.
Parlamentarier aus den verschiedensten Lagern entrüsten sich über das Wappenverbot für die Eishockeynati. Nationalräte haben Vorstösse eingereicht. Dieselben, die immer noch mehr Staat und damit immer noch mehr Beamte fordern, reden auf einmal vom «Amtsschimmel», den man «im Zaun halten müsse». Wie possierlich! Ein Pferd kann gezügelt werden. Aber nicht die Bürokratie. Die Politiker beschliessen Gesetze, deren Anwendung sie nicht kontrollieren können. Das alles geschieht in einem Bereich, der unserer Einflussnahme entzogen ist. Die Verwaltung ist ein Schattenreich, das uns alle im Griff hat. Uns alle vom Bundesrat bis zum Bauern im hintersten Bergtal.
Unser Mann im Institut für geistiges Eigentum meinte es doch nur gut. Er ist dafür angestellt, die Einhaltung der Gesetze zu überwachen, und genau das hat er getan. Wie aber können wir seinem pflichtbewussten Egotrip ein unbarmherziges Ende setzen? Wie können wir die Diktatur der Beamten stoppen?
Indem wir – wie beim Computer – den Stecker ziehen. Indem wir alle Bestrebungen unterstützen, die mehr Freiheit wollen und weniger Staat. Indem wir den Beamten die Löhne kürzen. Heute verdienen Bundesbeamte im Schnitt 117 000 Franken im Jahr. Dafür, dass sie nichts produzieren. Ein Traumjob. Mit unserem Geld.
Was können wir noch tun? Machen wir es wie die Eishockeynationalmannschaft. Mit dem Schweizerkreuz auf der Brust, so wie immer, ist sie an der WM gestartet. Das Wappenverbot kümmert sie nicht.