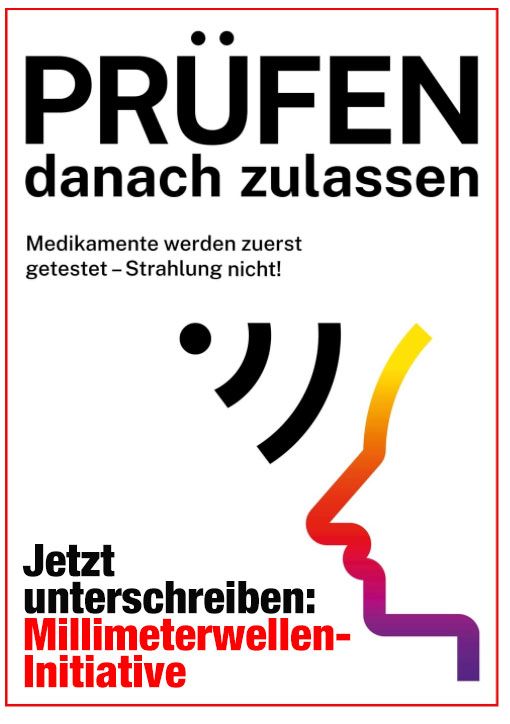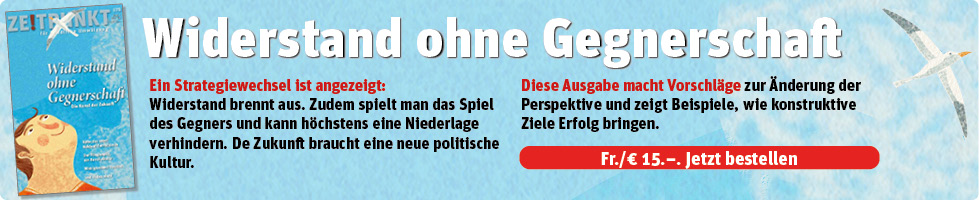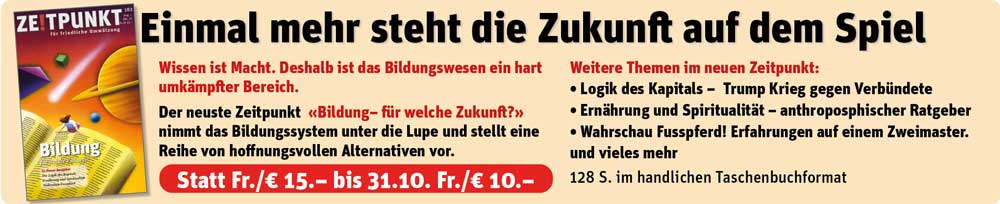Militärdienst habe ich nie geleistet. Und Zivildienst gab es damals noch gar nicht. Wer den Dienst in der Armee verweigerte, kam ins Gefängnis. In manchen Fällen ein ganzes Jahr. Weil ich mir das nicht antun wollte, wählte ich den einzig möglichen Notausgang: Ich machte medizinische Gründe geltend. So kam ich weg.
Warum wollte ich meine Bürgerpflicht nicht erfüllen? Schon als 18jähriger schrieb ich in mein Notizbuch: «Ich gelange immer mehr zur Erkenntnis, dass die Armee völlig sinnlos ist und abgeschafft werden sollte.»
Ich fand sie sinnlos. Das war natürlich kein Argument. Es war ein Gefühl, doch es begleitete mich wie eine Gewissheit. Und wenn ich etwas sinnlos finde, kann ich es nicht unterstützen.
Das war 1972. Neun Jahre später, 1981, konnte mich keine Realpolitik daran hindern, an einer Friedensdemo in Bern auf dem Bundesplatz die Abschaffung der Armee zu fordern. 1982 war ich dabei, als wir in Solothurn die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee gründeten und ein Volksbegehren lancierten. Unser kühnes Vorhaben, die Heilige Kuh zu schlachten, geschah nicht aus linkem Protestgehabe, sondern aus der Hoffnung heraus, unsere Initiative könnte mitten im lauernden Kalten Krieg ein Friedenssignal in die Welt hinaussenden - ein Zeichen, mit der Abrüstung ernst zu machen.
1989 gelangte unser Begehren zur Abstimmung. Es wurde zwar abgelehnt, aber mehr als ein Drittel der Stimmenden - 35,6 % oder 1 052 442 Stimmbürger – befürworteten die Abschaffung der Armee.
Doch die phänomenal hohe Zahl an Ja-Stimmen hatte keine weitere Konsequenz. Mit jedem Jahr wurde es stiller um das Ziel der Initiative, und heute wird die Armeeabschaffung wieder fast so betrachtet wie vorher: als nicht ernstzunehmendes, weltfremdes Träumchen unbelehrbarer Pazifisten.
Auch ich habe mich für eine Schweiz ohne Armee nie mehr öffentlich ausgesprochen. Doch an meiner Grundhaltung hat sich nichts geändert. Ich finde Armeen immer noch sinnlos. Ihr einziger Sinn besteht darin, zu töten und zu zerstören, und weder Töten noch Zerstören hat einen Sinn. Es hat auch dann keinen Sinn, wenn eine Armee sich als reines Verteidigungsinstrument sieht. Auch eine defensive Armee muss zerstören und töten, um zu verteidigen. Und sobald sie das tut, bekommt sie Feinde.
Wenn überhaupt eine Armee abgeschafft werden kann, glaubte ich damals, dann die schweizerische. Als neutrales Land, dessen Unabhängigkeit weltweit respektiert wird, könnte die Schweiz mit dem guten Beispiel vorangehen und auf den Milliarden verschlingenden Moloch einer Armee verzichten. Ich war überzeugt, kein Nachbarstaat und schon gar keine fernere Macht würde es wagen, das Tabu zu brechen und ein neutrales, unbewaffnetes, dem Frieden verpflichtetes kleines Land anzugreifen und zu erobern.
Im Gegenteil, dachte ich - andere Staaten würden dem Beispiel der Eidgenossenschaft folgen und ebenfalls mit dem Abbau ihrer militärischen Maschinerien beginnen. Je mehr Staaten keine Armee mehr besässen und damit ihre Schutzlosigkeit deklarieren würden, desto höher wäre die moralische Hürde für die verbleibenden Mächte, ein Volk zu erobern, das nichts in der Hand hält als eine weisse Fahne.
Ich bin davon heute noch überzeugt. Gerade in der gegenwärtigen politischen Lage, wo es in Europa wieder nach Pulverdampf riecht, wo eine Koalition der Böswilligen ganz Europa zu einem Feldzug gegen den «Feind» im Osten aufhetzen will, wo 80 Jahre danach wieder deutsche Geschosse auf russischem Gebiet einschlagen sollen – gerade heute wäre es umso dringender, dass die Schweiz erklärt: Wir machen nicht mit. Wir steigen aus. Wir erklären unser Land zur entmilitarisierten Zone.
Keine Armee zu haben und der Welt ein Ansporn zu sein, dasselbe zu tun – das wäre wirklich neutral. Unser Land als Ort für Verhandlungen anzubieten, ist noch keine mutige Tat. Sich zu entwaffnen und für alle Welt verwundbar zu machen, das hingegen wäre ein echter Beitrag zum Frieden auf unserer Erde.
*
Aber ich bin nicht blind für die Realität. Die Schweiz ist weiter denn je davon entfernt, abzurüsten. Die Armee soll nicht abgebaut, sondern ausgebaut werden. Und Ausbau bedeutet heute: mehr Kooperation mit dem europäischen Ausland. Mehr Zusammenarbeit mit der NATO.
Bisher galt: Manöver, die dem Training der Verteidigungsfähigkeit dienten, wurden grösstenteils nur im eigenen Land und mit den eigenen Truppen veranstaltet. Doch das ist vorbei. Der neue Armeeminister Martin Pfister – leidenschaftlicher Propagandist einer «Annäherung» der Schweiz an die EU und an die NATO – hat kein Vertrauen in die Stärke und Schlagkraft der Schweizer Armee. Auch die Neutralität sieht er nicht mehr als «Schutzschild», sondern als «Begrenzung». Mit anderen Worten: als Hindernis. Deshalb fordert er eine «stärkere Integration der Schweiz in die europäische Verteidigungsarchitektur».
«Unsere Antworten», sagte er bei einem Truppenbesuch, «müssen so grenzüberschreitend sein wie die Bedrohungen.»
Seine Vorgängerin Viola Amherd leistete schon viel wertvolle Vorarbeit. Im April 2024 zum Beispiel wurde das Schweizer Kontingent an der UNO-Mission im Kosovo um weitere zwanzig Soldaten erhöht, sodass nun über 200 Schweizer Armeeangehörige unter Führung der NATO Dienst im Kosovo leisten.
Im Dezember 2024 beteiligte sich die Schweizer Armee an der von der NATO organisierten internationalen Cyber-Defense-Übung «Cyber Coalition 24».
Im Januar 2025 übernahm die Schweiz das Präsidium der Partner Interoperability Advocacy Group, einer Gruppe von Nicht-NATO-Staaten, deren Ziel es ist, die Zusammenarbeit mit der NATO zu fördern.
Seit März 2025 nimmt die Schweiz an den Sitzungen eines Gremiums der NATO-Organisation für Wissenschaft und Technologie teil.
Im April 2025 beteiligte sich die Schweizer Armee mit 850 Soldaten, gemeinsam mit deutschen und österreichischen Truppen, am Manöver TRIAS 25 in Österreich. Dabei kamen NATO-Standards zur Anwendung, um die Kooperation mit der NATO zu optimieren.
Im Mai 2025 fanden im Bündnerland, im Glarnerland und am Simplon erste gemeinsame Trainings französischer und schweizerischer Panzer- und Artillerietruppen statt. Für die Durchfahrt der französischen Panzer war die Autobahn A13 zwischen Domat-Ems und Hinterrhein an zwei Abenden während mehrerer Stunden gesperrt.
Als mir diese letzte Meldung unter die Augen kam und ich das Bild dieser fremden Kampfpanzer sah, wie sie auf der A13 durch den Kanton Graubünden rollen, als dürften sie das – da wusste ich, dass diese Schweizer Armee nicht mehr dieselbe ist wie jene Institution, deren Abschaffung wir vor drei Jahrzehnten gefordert haben. Was wir damals vom Podest stürzen wollten, war zwar eine Armee, doch sie gehörte zur Schweiz. Ihr Milizcharakter verband sie mit allen Bürgerinnen und Bürgern des Landes. In ihr lebte noch immer ein wenig der Spirit der Landesverteidigung, der wachsame Geist von General Guisan, dessen Porträt noch immer an der Wand mancher Stube hing.
*
Wie hiess doch stets das geflügelte Wort? «Ein Land hat immer eine Armee: entweder die eigene oder eine fremde.» Doch für die Armee der Schweiz, so wie sie sich heute entwickelt, wird der Glaubenssatz neu formuliert werden müssen. «Ein Land hat immer eine Armee», wird es dann heissen, «entweder die eigene oder die eigene unter fremdem Oberkommando».
Bewaffnete Neutralität bedeutete bisher, dass unser Militär nur zum Einsatz kommt, wenn unser Land direkt attackiert wird. Doch je mehr sich die Schweiz der NATO «annähert», umso mehr wird die Schweizer Armee zu einer Truppengattung der NATO mutieren. Wenn dann der «Westen» zur Schlacht ruft, wenn Deutschland, England, Frankreich und ihre Vasallen den Endsieg wollen, werden auch Schweizer Soldaten irgendwann einrücken müssen. Seite an Seite mit NATO-Soldaten werden sie unter dem Banner der westlichen «Werteordnung» das östliche «Böse» bekämpfen müssen. Weil der Bundesrat – mit dem Segen des Parlaments – unser Land in die «europäische Verteidigungsarchitektur» integrieren will.
Dann ist’s vorbei mit der Neutralität. Dann werden die Russen definitiv unsere Feinde sein. Obwohl sie uns gar nicht bedrohten. Noch nie haben sie uns bedroht. Während ein Staat wie Deutschland vor nicht allzu langer Zeit an unseren Grenzen stand und ernsthaft plante, uns anzugreifen.
Eine Schweiz ohne Armee ist noch immer mein Traum. Angesichts der aktuellen Entwicklung jedoch müsste der Weckruf lauten:
FÜR EINE SCHWEIZ OHNE SÖLDNERARMEE!
Denn ein Heer, das unter fremdem Oberkommando steht, ist ein Söldnerheer. Doch während die Reisläuferei seinerzeit ein gutes Geschäft war - wird die Schweiz ihre Eingliederung in die europäische Kampffront teuer bezahlen müssen. Teuer in jeder Beziehung.
*
Bisher hiess es immer: Der Dienst in einer Milizarmee ist eine Lebensschule. Junge Männer lernen, sich durchzubeissen. Sie kommen zusammen mit Alterskollegen aus allen Schichten und Landesteilen. Sie lernen, was Kameradschaft und Zusammenhalt heisst. Der Militärdienst hätte insofern sicher auch mir nicht geschadet. Auf meine vorgetäuschten medizinischen Gründe, die mich damals vom Dienst befreiten, bin ich nicht stolz.
Doch eine Armee, die der NATO unterstellt ist, die nicht unser Land verteidigt, sondern westliche Interessen: In einer solchen Armee würde ich - wäre ich noch einmal jung - nicht mitmachen wollen. Denn die westlichen Interessen sind nicht die Interessen eines neutralen Landes. Ein neutrales Land will keine Hegemonie in Europa. Ein neutrales Land hat keine Feinde. Ein neutrales Land kann es gut mit der ganzen Welt.
Ich wünsche mir, dass die jungen, militärdiensttauglichen Männer von heute erkennen, in was für eine Armee sie eintreten sollen. Ich wünsche mir, dass sie für sich entscheiden: Wir wollen keine Söldner in fremden Diensten sein. Wir wollen uns nicht an Manövern im Ausland beteiligen, und wir möchten auch keine fremden Panzer im Bündnerland sehen. Vor allem aber möchten wir keinen Krieg führen, der nicht unser Krieg ist. Wir sind der Schweiz verpflichtet und niemandem sonst.