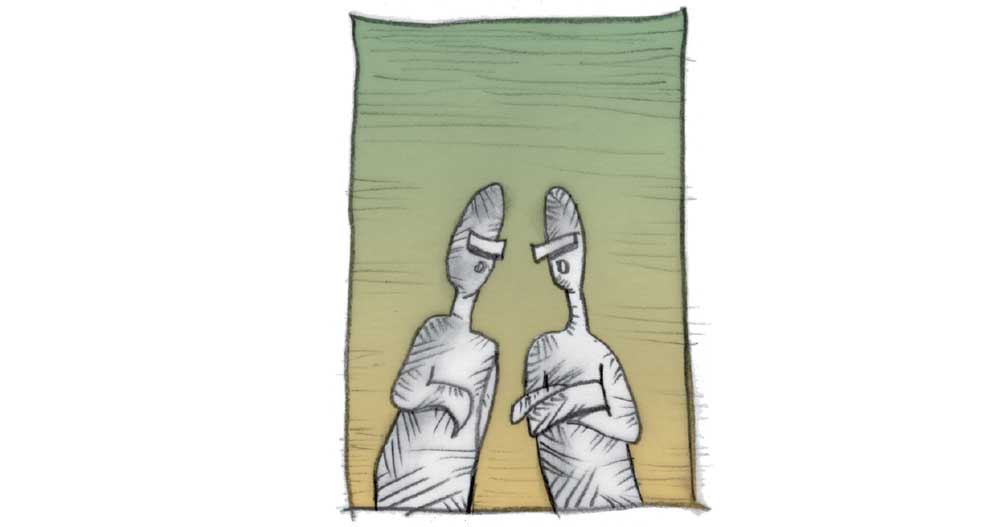Für Veränderung sein, bedeutet, gegen das Bestehende zu sein. Wer eine enkeltaugliche Zukunft befördern will, lehnt Atom- und Kohlekraftwerke, SUVs und eine monokulturelle Landwirtschaft ab. Und wer die Demokratie voranbringen möchte, hat eine schlechte Meinung über Diktatoren oder alternative Fakten des US-Präsidenten Donald Trump.
Wer dagegen ist, opponiert gegen aktuelle Zustände – und hat es schwer, sich durchzusetzen. Denn es muss Bewegung erzeugt werden gegen die Trägheit des Faktischen. Derweil machen es sich Befürwortende oder Ignoranten im Sessel der Realität bequem: Sie müssen nichts tun, solange das Sitzmöbel fest am Boden steht. Mächtige Interessen haben den gesellschaftlichen und politischen Raum eingerichtet, und oft haben sich Gewohnheiten über lange Zeiträume so stark verfestigt, dass sie den meisten als unhinterfragbar erscheinen. «Wirtschaftswachstum ist notwendig», «Geld regiert die Welt» und «Schnell ist besser als langsam» sind solche tief verankerten Glaubenssätze. Die alltäglichen Erfahrungen und die bestehende Infrastruktur stützen diese Positionen – und schon das Nachdenken darüber, wie sie zu überwinden seien, erscheint vielen als weltfremd und überflüssig.
Sich mit der eigenen Machtlosigkeit konfrontieren – das passiert, wenn man sich in Opposition zu den herrschenden Verhältnissen begibt. Die Anti-AKW-Bewegung entstand in den 1970er-Jahren und bis in Deutschland auf ihren Druck hin der Atomausstieg beschlossen wurde, vergingen Jahrzehnte. Dass in Irland und Österreich geplante oder bereits gebaute AKWs erst gar nicht ans Netz gingen, zeigt, dass Proteste gegen Veränderungen auf die Schwerkraft des Hergebrachten und Gewohnten setzen können und damit mehr Aussicht auf schnellen Erfolg haben: Verhindern ist leichter als Abschaffen.
Ein «Dagegensein», das keine Alternative entwickelt, fällt als Bewegung über kurz oder lang in sich zusammen. Die Occupy-Bewegung war der grösste Proteststurm in den USA gegen die Macht der Banken- und des Finanzsektors und gegen den Einfluss der grossen Wirtschaft auf die Politik. Doch die Forderungen blieben Anspruch und Anklage, und so ging der Bewegung bald die Puste aus. Was bleibt – und das ist nicht gering zu schätzen –, ist die reale Erfahrung vieler Beteiligter, neue Formen von Kommunikation, Gemeinschaft und Solidarität erlebt zu haben. Für eine kurze Zeit war spürbar: Etwas anderes als das, was im Alltag dominiert, ist möglich. Für eine neue Welle des Aufbegehrens könnte das eine wichtige Mitgift werden.
Wer langfristig wirksam werden will, muss immer auch ein «Dafür» aufbauen. Die Anti-AKW-Bewegung hat schon früh angefangen, Alternativen zu entwickeln. Tüftler stellten erste Windräder auf und experimentierten mit Solarpanelen, um Glühbirnen zu erleuchten oder Rührgeräte für Kuchenteig zum Laufen zu bringen. Und sie überlegten, wie ein gutes Gesetz aussehen müsste, um solche Techniken zu verbreiten. Lange Zeit blieben ihre Aktivitäten unter dem Radarschirm der etablierten Konzerne. Als diese dann irgendwann mitkriegten, dass es da einen Gegner gab, der die hergebrachten Strukturen nicht nur kritisieren, sondern etwas Neues aufbauen wollte, vesuchten sie die Newcomer als unverantwortliche Aufschneider darzustellen. Windenergie könne in Deutschland aus klimatischen Bedingungen niemals auch nur ein Prozent des Strombedarfs decken, behaupteten die Betreiber der Atommeiler 1990 – und bezichtigten ihre Gegner als unverantwortlich gegenüber dem Rest der Welt. «Der steigende Energiebedarf der dritten Welt verpflichtet die reichen Staaten, ihre CO2-Emissionen zu mindern. Schaffen wir das ohne Kernkraft, allein durch Energiesparen? Nein ...», hiess es in einer Anzeige, die unterschrieben war mit «Ihre Stromversorger». Doch tatsächlich begann ihre Monopolstellung rasch zu zerbröseln: Bürgerinitiativen gründeten Genossenschaften und kauften Stromnetze – und dank des zwischenzeitlich verabschiedeten Erneuerbare-Energien-Gesetzes entstanden bald wirtschaftlich tragfähige Unternehmen und Strukturen.
Viele Zeitgenossen gefallen sich darin, eine kritische Haltung an den Tag zu legen und sich ansonsten recht gut mit ihren dystopischen Vorstellungen einzurichten. Wer in einer Demokratie lebt, befindet sich in der komfortablen Lage, ohne Risiko rummosern zu können und darauf einen Rechtsanspruch zu haben. Nicht wenige fühlen sich schon ausreichend aktiv, wenn sie nur eine politische Zeitschrift abonnieren oder beim Feierabendbier über umwälzende Ideen diskutieren. Die Klage, gegen die übermächtigen Strukturen eh nichts ausrichten zu können, adelt die eigene Passivität und die fehlende Risikobereitschaft, selbst etwas in Hand zu nehmen. Je radikaler die Kritik, desto grösser die Überzeugung, Recht zu haben und zur erlauchten Gruppe der Vordenkeden zu gehören.
Andere geniessen es, in einer Demo mitzutrotten und den warmen, schützenden Raum einer gleichschwingenden Masse zu spüren, die «gegen die da oben» sind. Dass solche Menschen die Atmosphäre einer Gesellschaft grundlegend beeinflussen können, lässt sich gegenwärtig leider gerade an vielen Orten beobachten. Gegen Ausländer oder irgendwie als «anders» definierte Menschen zu sein, hat als einziges gemeinsames «Für» den Wunsch, Unbekanntes abzuwehren und unter sich und seinesgleichen zu bleiben. Ein persönliches Wagnis ist für die Mitläufer damit nicht verbunden – und dadurch wirken diese Bewegungen anziehend wie ein Staubsaugerrohr.
Menschen, die etwas Neues ausprobieren und sich für eine echte Alternative engagieren, gehen dagegen nicht nur das Risiko ein, zu scheitern. Sie haben auch viele Zeitgenossen gegen sich. Zum einen sind da die Platzhirsche. Sobald sich ein neuer Player nicht länger ignorieren lässt, wird er scharf beobachtet und im fortgeschrittenen Stadium auch massiv bekämpft. Kritik von Menschen, die es sich mit der Lektüre verbalradikaler Schriften auf dem Sofa bequem gemacht haben, ist ebenso gewiss. Kein Projekt kommt ohne Kompromisse und innere Widersprüche aus - und auf die werden sich diese Kritiker stürzen. Schliesslich gibt es dann auch noch die Gruppe derjenigen mit ausgeprägten Ohnmachtsgefühlen. Zwar meckern sie ständig, dass alles schiefläuft und unbedingt ganz viel geändert werden muss. Doch der neue Ansatz ist in ihren Augen natürlich viel zu klein und die Gegner viel zu mächtig, als dass sich dadurch irgendetwas ändern könnte.
Wer sich auf den Weg macht, die Welt anders zu gestalten, muss sich auf Gegenwind einstellen und in fortgeschrittenem Stadium auch auf einen Orkan. Zugleich aber steckt in solchem Handeln auch eine grosse Kraft: Etwas eigensinnig und kompromisslos ganz nach eigenen Vorstellungen aufzubauen, ist hoch befriedigend. Wenn auch zunächst oft nur bei ganz kleinen Schritten, so ist doch der eigene Einfluss spürbar. Schliessen sich Menschen mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Kenntnissen für ein gemeinsames Ziel zusammen, kann das die Energie der einzelnen schnell potenzieren und einen Flow bewirken. Der zieht häufig weitere Menschen an, die teilhaben wollen, indem sie selbst etwas zum Gelingen beitragen. So etwas ist kein gezielter Prozess mit Masterplan, bei dem am Anfang schon feststeht, was am Ende herauskommen soll. Vielmehr sind es dynamische Such- und Entwicklungsbewegungen, bei denen gemeinsame Werte und Wünsche als Kompass dienen – und wer sich hier intensiv einbringt, macht die Erfahrung, dass es auf den jeweils eigenen Beitrag tatsächlich ankommt.
Ein Beispiel für solch einen erfolgreichen Gegenentwurf zum Mainstream sind die Schönauer Stromrebellen. Sie fingen ganz klein an: Nach dem GAU von Tschernobyl veranstalteten einige Leute in einem Schwarzwaldkaff Stromsparwettbewerbe unter Nachbarn. Damit wollten sie einen konkreten Beitrag leisten gegen die Produktion von Atomstrom. Als ihr Elektrizitätslieferant dann allerdings mit Klagen drohte, weil ihr Verhalten geschäftsschädigend sei, entwickelte die Bürgergruppe mit Hilfe von vielfältigen Unterstützenden aus der ganzen Republik ein eigenes Elektrizitätswerk. Inzwischen sind die EWS deutschlandweit tätig und liefern ihrer Kundschaft ausschliesslich erneuerbaren Strom. Das Beispiel belegt: Nicht Kritik verändert die reale Welt, sondern erste Schritte in die richtige Richtung, die dann weitere nach sich ziehen. Jedes Dagegen braucht auch ein Dafür.
________________
Mehr zum Thema «dafür | dagegen» in Zeitpunkt 158